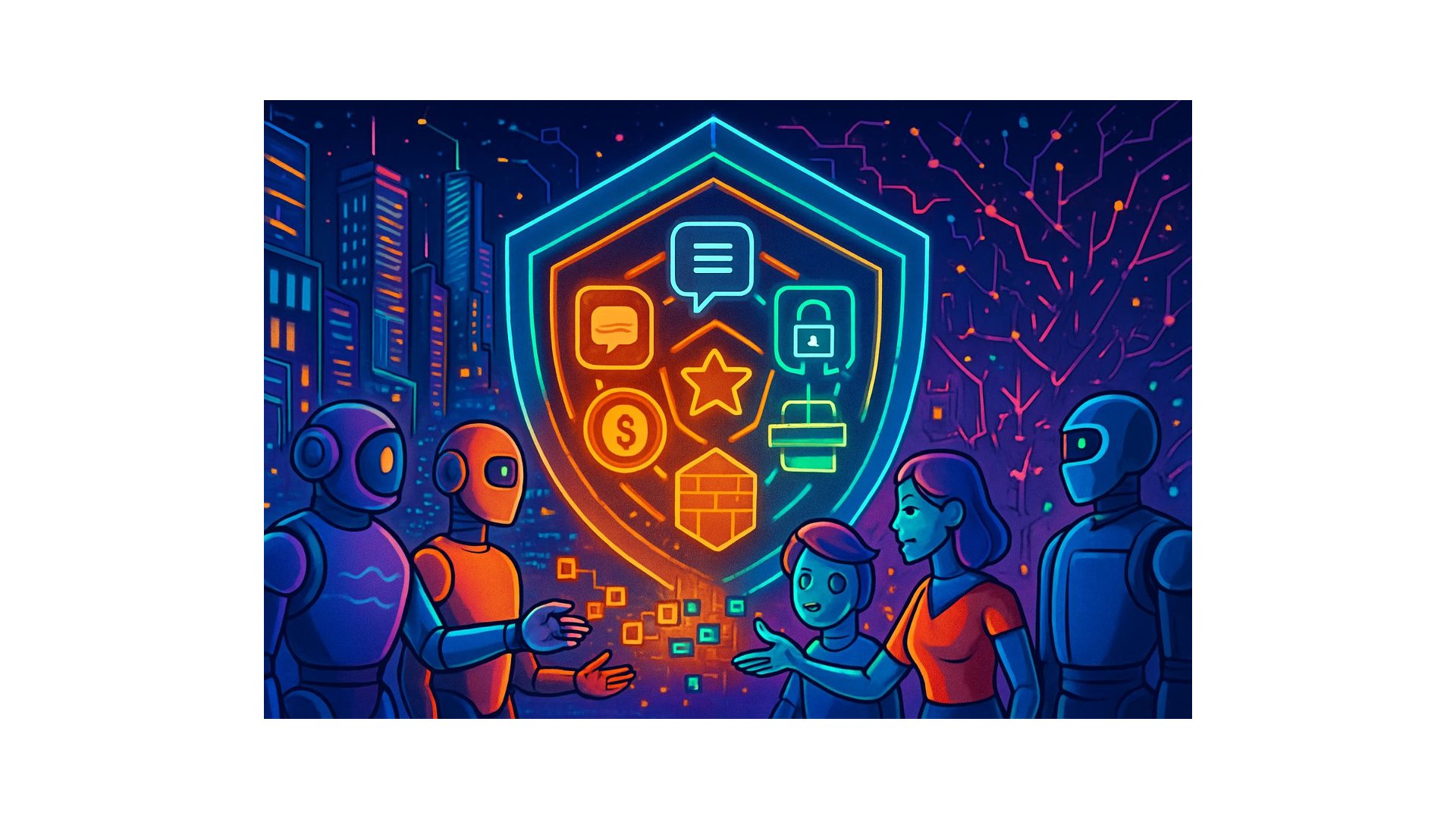Wenn Milliarden KI-Agenten autonom interagieren, verschiebt sich eine uralte gesellschaftliche Frage in die Architektur der Protokolle: Wem kann man trauen, und warum? Die Antwort entscheidet darüber, ob das entstehende “Agentic Web” zur robusten Infrastruktur oder zum chaotischen Wildwuchs wird.
Vertrauen war lange eine genuin menschliche Angelegenheit – eine soziale Leistung, die auf Erfahrung, Reputation und institutioneller Einbettung beruhte. Niklas Luhmann beschrieb Vertrauen bekanntlich als Mechanismus zur Reduktion sozialer Komplexität: Wir vertrauen, weil wir nicht alles wissen können, nicht alles kontrollieren können, und dennoch handeln müssen. Doch was geschieht, wenn die Interaktionspartner keine Menschen mehr sind, sondern KI-Agenten? Wenn Milliarden autonomer Systeme auf Basis großer Sprachmodelle miteinander kommunizieren, Transaktionen ausführen, Informationen austauschen – ohne dass Menschen noch jeden Schritt überwachen können oder wollen?
Die aufkommende Architektur des sogenannten “Agentic Web” stellt diese Frage nicht philosophisch, sondern protokollarisch: Vertrauen wird zur Infrastrukturfrage. Es geht nicht mehr primär um psychologische Dispositionen oder soziale Konventionen, sondern um die technische Gestaltung der Kommunikationsprotokolle selbst. Wer hier versagt, riskiert nicht nur einzelne Fehltransaktionen, sondern systemische Instabilität in Größenordnungen, die menschliche Aufsicht überfordern würden.
Eine aktuelle Studie1Inter-Agent Trust Models: A Comparative Study of Brief, Claim, Proof, Stake, Reputation and Constraint in Agentic Web Protocol Design—A2A, AP2, ERC-8004, and Beyond analysiert sechs fundamentale Vertrauensmodelle, die in Inter-Agenten-Protokollen wie Googles A2A, dem Agent Payments Protocol (AP2)…