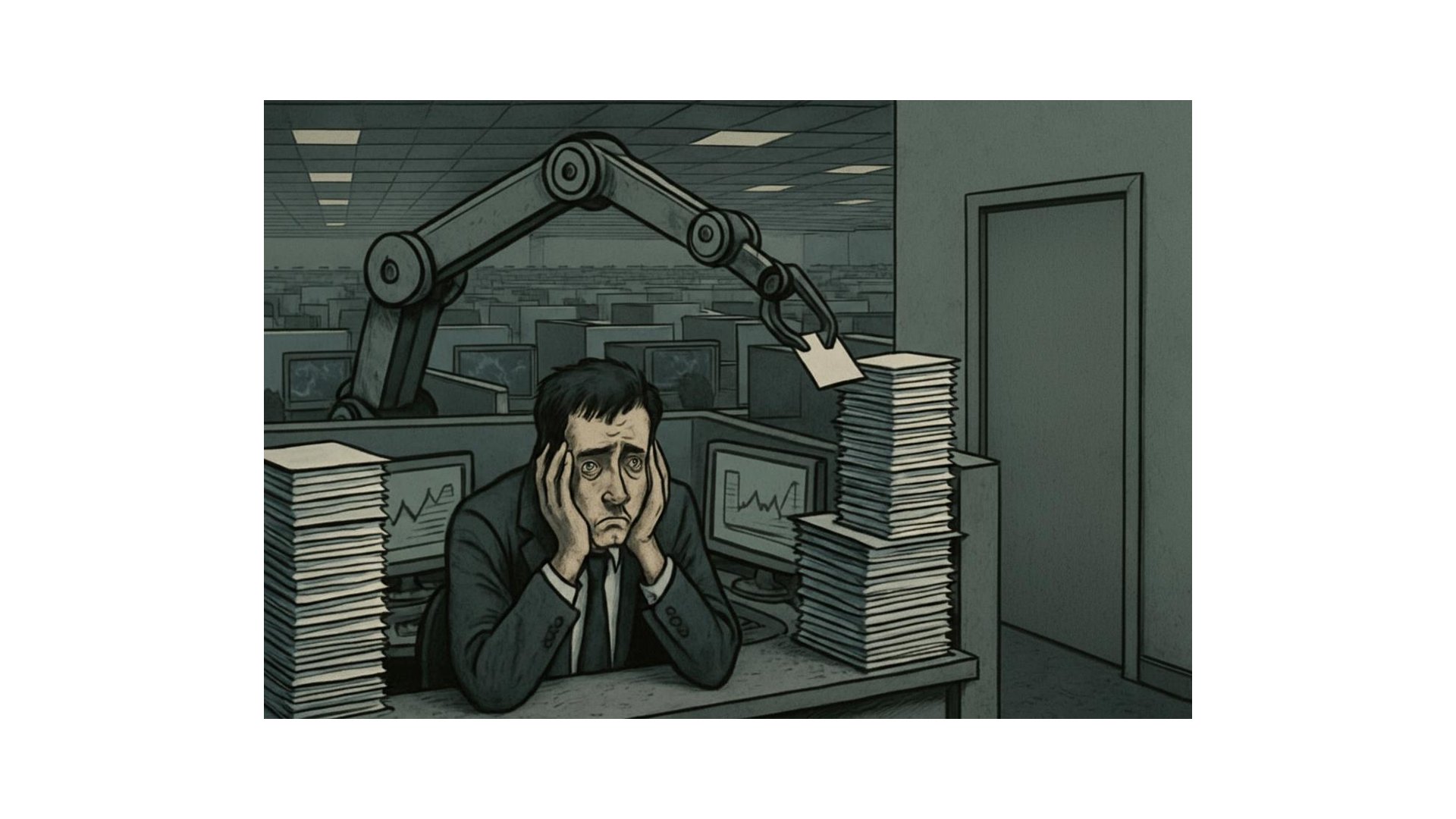Millionen Menschen verbringen ihre Arbeitstage in Tätigkeiten, die sie selbst für nutzlos halten. Der Anthropologe David Graeber nannte sie „Bullshit-Jobs” – eine Provokation, die eine längst fällige Debatte auslöste. Doch wie viele solcher Jobs gibt es wirklich? Und liegt das Problem in der Arbeit selbst oder in den Strukturen, die sie hervorbringen?
Es gibt einen besonderen Schmerz, der sich einstellt, wenn man Montagmorgen vor dem Computer sitzt und weiß: Was ich heute tue, ist vollkommen belanglos. Nicht anstrengend, nicht schwierig – einfach überflüssig. Der Anthropologe David Graeber gab diesem diffusen Unbehagen 2013 einen Namen: Bullshit-Jobs. Seine These war radikal: Ein erheblicher Teil der modernen Erwerbsarbeit besteht aus Tätigkeiten, die weder dem Einzelnen noch der Gesellschaft einen erkennbaren Nutzen bringen. Schlimmer noch: Die Betroffenen wissen das – und müssen sich täglich selbst belügen.
Graeber sprach von „geistiger Gewalt”, von einer Form der Entfremdung, die tiefer greift als körperliche Ausbeutung. Wer acht Stunden am Tag E‑Mails weiterleitet, die niemand liest, wer Berichte erstellt, die in Schubladen verschwinden, wer Meetings koordiniert, deren Ergebnisse folgenlos bleiben – der wird zum Komplizen der eigenen Bedeutungslosigkeit. Die moralische Dimension dieser Diagnose ist beträchtlich: Eine Gesellschaft, die Menschen zwingt, ihre Zeit in erkennbar sinnlosen Tätigkeiten zu verbringen, zerstört nicht nur Produktivität, sondern auch Würde.
Transformation als Maßstab
Der Sozialanthropologe Andrew Sanchez bringt eine wichtige Differenzierung ein. Arbeit wird dann als befriedigend erlebt, wenn sie Transformation ermöglicht – wenn man durch sie die Welt, andere Menschen oder sich selbst verändert. Das Problem vieler Jobs liegt also nicht unbedingt in ihrer objektiven Nutzlosigkeit, sondern in der fehlenden Erfahrung von Wirksamkeit. Sanchez kritisiert zugleich Graebers Kapitalismuskritik als zu eindimensional: Der Kapitalismus mag viele Übel hervorbringen, aber seine zentrale Motivation bleibt der Profit. „Sinnlose” Tätigkeiten existieren selten völlig außerhalb dieser Logik – oft erfüllen sie organisationale Funktionen, die nur nicht unmittelbar erkennbar sind.
Zudem warnt Sanchez vor vorschnellen moralischen Urteilen. Selbst objektiv destruktive Tätigkeiten – etwa in der Werbung, im Glücksspiel oder in bestimmten Bereichen der Finanzindustrie – können subjektiv als erfüllend erlebt werden, wenn sie Könnerschaft, Kreativität oder soziale Anerkennung ermöglichen. Die Frage nach dem Sinn von Arbeit ist also komplexer, als Graeber suggeriert.
Die Größe macht den Unterschied
David Heinemeier Hansson, Unternehmer und Softwareentwickler, lenkt den Blick auf die organisationale Dimension. Große Unternehmen, so seine These, erzeugen strukturell Bullshit-Jobs. Je größer die Organisation, desto mehr Schichten von Bürokratie, Risikomanagement und Verantwortungsdiffusion entstehen. In einem Konzern mit 50.000 Mitarbeitern kann sich niemand mehr ein klares Bild davon machen, wer tatsächlich Wert schafft und wer nur Papier bewegt. Die Intransparenz wird zur Überlebensstrategie für Positionen ohne erkennbaren Output.
Kleine Unternehmen hingegen sind gnadenlos transparent. Dort sieht jeder, wer produktiv ist und wer nicht. Hansons Warnung ist eindringlich: Das größte Risiko im modernen Arbeitsleben sei nicht mehr die Arbeitslosigkeit, sondern das langsame „Verrosten” in einer Position, die einen weder fordert noch wertschätzt – ein Zustand, der langfristig die berufliche Identität beschädigt.
Die empirische Ernüchterung
Eine großangelegte Studie der Universitäten Cambridge und Birmingham brachte 2023 ernüchternde Zahlen. Nur etwa 4,8 Prozent der Befragten hielten ihre Arbeit für selten oder nie nützlich – weit weniger als Graebers vermutete 20 bis 50 Prozent. Sind Bullshit-Jobs also nur eine akademische Fiktion, eine Projektion privilegierter Intellektueller?
Nicht ganz. Denn die Studie bestätigte die psychologischen Kernaussagen: Menschen, die ihre Arbeit als nutzlos empfinden, leiden signifikant häufiger unter psychischen Belastungen. Entscheidend ist allerdings: Der Sinnverlust entsteht weniger aus der Tätigkeit selbst als aus den Arbeitsbedingungen. Mangelnder Respekt durch Vorgesetzte, ineffizientes Management, permanenter Zeitdruck und fehlende Autonomie – das sind die eigentlichen Treiber der Entfremdung. Der Soziologe Brendan Burchell formuliert es so: Graebers Verdienst liegt nicht in der Quantifizierung, sondern darin, das Thema psychologischer Sinnverlust überhaupt wieder auf die Agenda gesetzt zu haben.
Der Leerlauf der Rationalität
Henrique Schneider und Gunter Dueck erweitern die Kritik zur Systemanalyse. Das Problem ist nicht nur die Größe von Organisationen, sondern die Logik der „Überverwaltung” selbst. Moderne Arbeitswelten sind durchsetzt von Evaluations‑, Kontroll- und Dokumentationsprozessen, die sich längst verselbstständigt haben. Jede Tätigkeit muss messbar sein, jeder Erfolg quantifizierbar, jeder Prozess standardisiert. Das Ergebnis: selbstreferenzielle Bürokratien, die sich primär mit sich selbst beschäftigen.
Dueck spricht vom „Leerlauf der Rationalität” – einer Kultur, die den Sinn aus der Arbeit herausdefiniert, weil sie nur noch Effizienzkennzahlen kennt, nicht aber kreative oder menschliche Maßstäbe. In großen Organisationen überleben solche „Fülljobs” besonders leicht, weil Aufwand und Verantwortung entkoppelt sind. Man produziert Berichte, die andere Berichte legitimieren sollen, die wiederum die Grundlage für weitere Berichte bilden – ein Kreislauf ohne Außenbezug.
Die Maschine als Sinnrichter
Und nun kommt die Technologie ins Spiel – ausgerechnet sie, die einst versprach, uns von sinnloser Routinearbeit zu befreien. Generative KI und fortgeschrittene Robotik stellen die Bullshit-Jobs-Debatte auf den Kopf, denn sie enthüllen eine paradoxe Wahrheit: Viele der Tätigkeiten, die Menschen als sinnlos empfinden, erweisen sich als zu komplex für Maschinen. Und umgekehrt: Manches, was als bedeutsam galt, lässt sich automatisieren.
Die bittere Ironie besteht darin, dass KI-Systeme ausgerechnet jene administrativen, dokumentierenden und klassifizierenden Tätigkeiten übernehmen könnten, die Graeber als Bullshit-Jobs identifizierte. Berichte schreiben, Daten zusammenfassen, Routinekorrespondenz führen – genau das, was Menschen entfremdet, macht Algorithmen nichts aus. Sie leiden nicht unter Sinnlosigkeit. Die Frage ist nur: Was geschieht mit den Menschen, deren Jobs zwar als „Bullshit” galten, aber immerhin ein Einkommen sicherten?
Gleichzeitig zeigt sich: Viele vermeintlich „wertvolle” kreative oder analytische Tätigkeiten lassen sich teilweise automatisieren – während ausgerechnet Pflege, Handwerk und persönliche Dienstleistungen, also Tätigkeiten mit unmittelbarem Transformationscharakter, sich der Automatisierung entziehen. Die Technologie könnte somit zu einem unfreiwilligen Prüfstein werden: Was wirklich Sinn macht, zeigt sich daran, was Menschen anderen Menschen bedeutet – und was nur formaler Vollzug ist.
Doch die Automatisierungsdebatte droht eine zentrale Einsicht zu verschleiern: Nicht die Existenz von Bullshit-Jobs ist das Kernproblem, sondern die Bedingungen, unter denen gearbeitet wird. Selbst wenn KI die überflüssigen Tätigkeiten eliminiert – was geschieht, wenn die verbleibenden Jobs unter denselben Bedingungen stattfinden? Unter mangelndem Respekt, permanenter Kontrolle, fehlender Autonomie? Dann hätten wir nur effizientere Entfremdung geschaffen.
Die technologische Disruption zwingt uns also zu einer Grundsatzfrage: Wollen wir Arbeit primär als Einkommensquelle oder als Quelle von Sinn und Identität verstehen? Wenn KI tatsächlich einen großen Teil der Erwerbsarbeit überflüssig macht, müssen wir neu definieren, wie Menschen Bedeutung, Anerkennung und materielle Sicherheit gewinnen. Das bedingungslose Grundeinkommen, verkürzte Arbeitszeiten, neue Formen der Wertschöpfung – all das sind keine utopischen Spinnereien mehr, sondern Antworten auf eine Realität, in der die Maschine zum Sinnrichter wird.
Entkopplung von Sinn und Struktur
Was bleibt von der Bullshit-Jobs-Debatte im Zeitalter intelligenter Maschinen? Graeber hat eine Wunde berührt, die nun technologisch aufgerissen wird. Das eigentliche Problem liegt in der zunehmenden Entkopplung von Sinn, Verantwortung und Wirkung in modernen Arbeitsverhältnissen – und diese Entkopplung wird durch Automatisierung nicht verschwinden, sondern sich möglicherweise verschärfen.
Die Lösung kann nicht darin bestehen, einfach „sinnlose” Stellen zu streichen oder durch Algorithmen zu ersetzen. Vielmehr geht es darum, Arbeitsbedingungen zu schaffen, in denen Menschen Autonomie erleben, Respekt erfahren und die Auswirkungen ihres Handelns nachvollziehen können. Transformation braucht Transparenz. Und vielleicht auch: kleinere Einheiten, kürzere Entscheidungswege, weniger Kontrolle, mehr Vertrauen – gerade weil Maschinen uns immer mehr Routinen abnehmen.
Am Ende geht es nicht um die Frage, ob ein Job „Bullshit” ist oder ob ihn demnächst ein Algorithmus erledigt. Es geht darum, ob ein Mensch in seiner Arbeit sich selbst wiedererkennen kann – oder ob er jeden Abend nach Hause geht mit dem Gefühl, einen weiteren Tag gegen seine eigene Überzeugung gelebt zu haben. Die Maschinen werden uns diese Frage nicht abnehmen. Im Gegenteil: Sie machen sie dringlicher denn je.
Quelle: