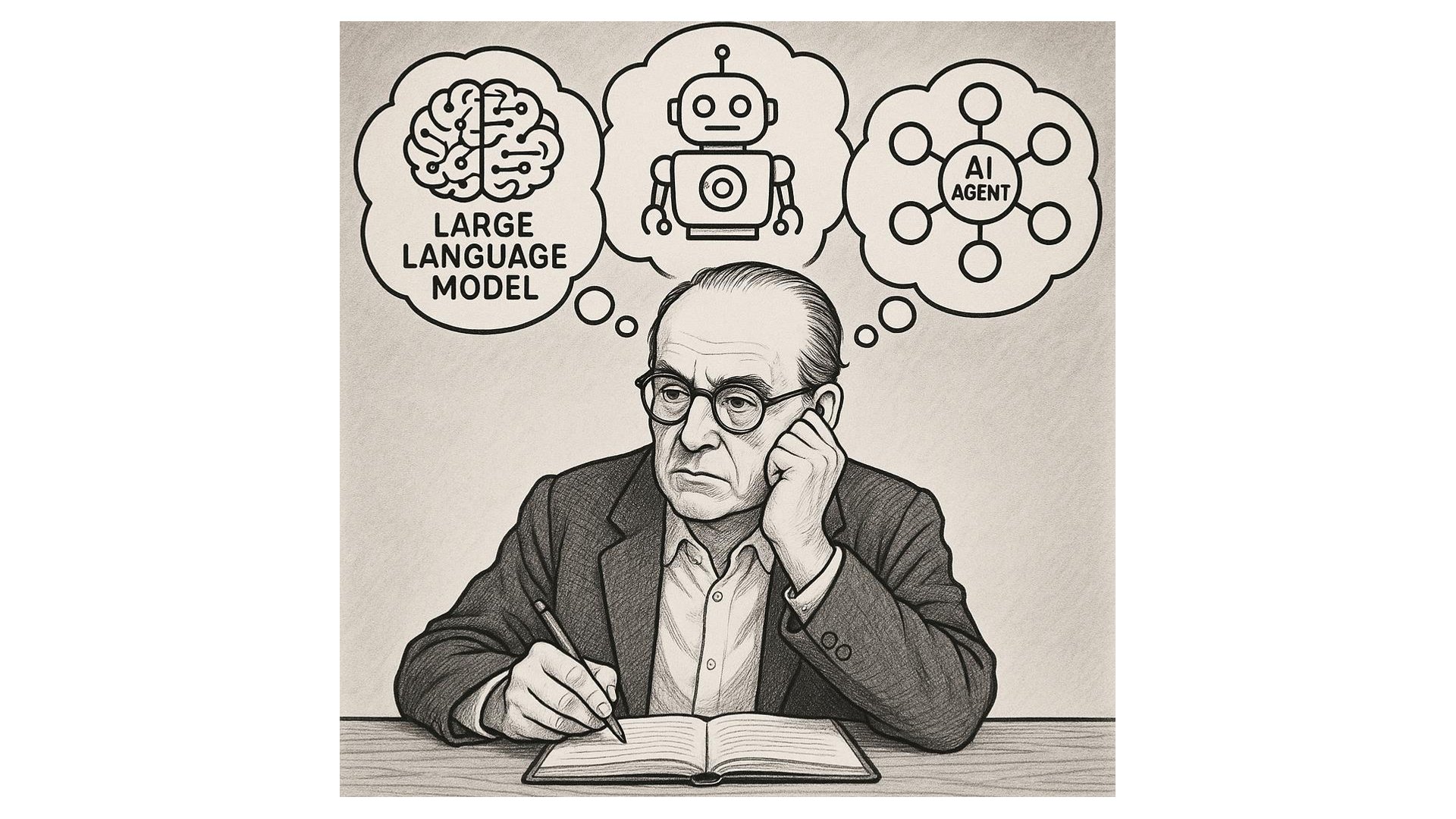Von Ralf Keuper
Gilbert Simondons Schrift Die Existenzweise technischer Objekte entfaltet ihre Relevanz besonders in der heutigen, digitalisierten Welt, etwa durch Phänomene wie das Smart Home oder das Internet der Dinge und neuerdings durch die Verbreitung großer Sprachmodelle und generativer KI. Simondon argumentiert, dass technische Objekte durch interne Umverteilung von Funktionen zu synergetischen Einheiten fortschreiten, bei denen nicht einzelne Funktionen, sondern Funktionsgruppen entscheidend sind. Diese Sichtweise weist Parallelen zu Multiagentensystemen und der Synergetik von Hermann Haken auf1Die Existenzweise technischer Objekte (Gilbert Simondon).
Simondon schreibt:
Die Spezialisierung jeder Struktur ist die Spezialisierung einer positiven synthetisch-funktionalen Einheit, die von unerwünschten Sekundäreffekten befreit ist, welche die Funktionsweise abschwächen; das technische Objekt schreitet durch die interne Umverteilung der Funktionen auf kompatible Einheiten voran, die an die Stelle der Zufälligkeit oder des Antagonismus der ursprünglichen Verteilung treten; die Spezialisierung erfolgt nicht >Funktion für Funktion<, sondern >Synergie für Synergie<; es ist die synergetische Funktionsgruppe und nicht die einzelne Funktion, die das wirkliche Sub-Ensemble im technischen Objekt bildet.
Zum Begriff der Information beschreibt Simondon sie als Zwischenzustand zwischen Zufälligkeit und Regelmäßigkeit. Information entsteht durch die Reduktion von Unbestimmtheit innerhalb bestimmter Grenzen, wobei ein Spielraum der Unbestimmtheit erhalten bleiben muss, um neue Bedeutung zu generieren.
In Simondons Worten:
Die Information ist wie ein Zufallsereignis und doch unterscheidet sie sich von ihm. Eine absolute Stereotypie, die jede Neuigkeit ausschließt, schließt auch jede Information aus. Um die Information von Geräusch zu unterscheiden, stützt man sich gleichwohl auf das Merkmal, dass Unbestimmtheit auf bestimmte Grenzen reduzieren lässt. … ; damit die Informationsnatur des Signals fortbesteht, muss ein bestimmter Unbestimmtheitsspielraum fortbestehen. Die Vorhersehbarkeit ist ein Grund, der diese zusätzliche Präzisierung empfängt und der sie in einer sehr großen Zahl von Fällen schon im Voraus vom reinen Zufall unterscheidet, indem er sie teilweise präformiert. Die Information liegt somit auf halbem Weg zwischen reinem Zufall und Regelmäßigkeit.
Der Mensch wird als Vermittler zwischen Maschinen gesehen, da diese keine eigenständige Information erzeugen, sondern lediglich Formen modifizieren. Nur ein Lebewesen kann die Funktionsweisen von Maschinen interpretieren und in neue Kontextformen übersetzen.
Es erscheint also als die Aufgabe des menschlichen Individuums, die in den Maschinen eingelagerten Formen in Informationen zu konvertieren; die Operation der Maschinen lässt keine Information entstehen, sondern sie ist lediglich eine Montage und Modifikation von Formen; das Funktionieren einer Maschine hat keinen Sinn, es kann nicht zu wirklichen Informationssignalen für eine andere Maschine führen; es bedarf eines Lebewesens als Mediateur, um einen Funktionsablauf in Begriffen der Information zu interpretieren und ihn wieder in Formen für eine andere Maschine zu konvertieren.
Die Idee eines vollkommenen Automaten, der ohne Unbestimmtheitsspielraum Informationen verarbeitet, hält Simondon für widersprüchlich, da völlige Vorhersehbarkeit keine Bedeutung oder Informationsdynamik mehr zulässt.
Die Vorstellung eines vollkommenen Automaten ist eine Vorstellung, die aus einem Übergang zur Grenze gewonnen ist und sie birgt in sich etwas Widersprüchliches: Der Automat wäre eine so vollkommene Maschine, dass der Unbestimmtheitsspielraum für ihr Funktionieren gleich null wäre, die aber dennoch Informationen empfangen, interpretieren oder aussenden können. Wenn aber der Unbestimmtheitsspielraum für ihr Funktionieren gleich null ist, gibt es keine Möglichkeit zur Variation mehr; das Funktionieren wiederholt sich unbegrenzt in identischer Form und folglich enthält diese Iteration keinerlei Bedeutung.
Einschätzung
Einige der Aussagen Simondons können als widerlegt, zumindest als relativiert angesehen werden. Denn, dass die Operation der Maschinen keine Information entstehen lässt, sondern es sich dabei lediglich um eine Montage und Modifikation von Formen handelt und folglich das Funktionieren einer Maschine keinen Sinn hat, da es nicht zu wirklichen Informationssignalen für eine andere Maschine führen kann, lässt sich heute so nicht mehr aufrechterhalten. Multiagentensysteme und agentenbasierte Workflows, die bei der Erledigung von Aufgaben und der Reaktion auf nicht programmierbare Ereignisse über verschiedene Abteilungen und sogar über Unternehmensgrenzen bei der Erledigung von Aufgaben hinweg kommunizieren und interagieren können, erzeugen sehr wohl Informationssignale für andere Maschinen. Sie agieren nicht mehr nur vorhersehbar, regelbasiert.
Was sagt Perplexity dazu?
Auf die Frage an Persplexity, inwieweit sich die Textpassagen von Simondon auf Große Sprachmodelle, KI-Agenten und Multiagentensysteme anwenden lassen, kam zur Antwort:
Gilbert Simondons Philosophie der Technik bietet relevante Perspektiven auf die Entwicklung und Funktionsweise von KI-Agenten, großen Sprachmodellen (LLMs) und Multiagentensystemen. Seine Konzepte der Konkretisierung, Synergie und Information lassen sich wie folgt anwenden:
Konkretisierung und synergetische Spezialisierung
Simondon beschreibt technische Objekte als Systeme, die durch interne Umverteilung von Funktionen fortschreiten, um „unerwünschte Sekundäreffekte“ zu eliminieren und Kompatibilität zwischen Einheiten herzustellen. Dies geschieht nicht durch isolierte Funktionsoptimierung, sondern durch Synergiebildung .
- KI-Agenten und LLMs: Moderne Sprachmodelle integrieren beispielsweise Textgenerierung, Logik und Kontextverarbeitung in eine einzige Architektur (z. B. Transformer). Diese „Plurifunktionalität“ – etwa, dass Aufmerksamkeitsmechanismen sowohl semantische Beziehungen als auch Syntax regeln – entspricht Simondons Idee der synergetischen Sub-Ensembles .
- Multiagentensysteme: Hier entsteht Fortschritt durch die Koordination von Agenten, die sich gegenseitig stabilisieren („interne Resonanz“). Ein Beispiel sind Schwarmalgorithmen, bei denen die kollektive Intelligenz nicht auf einzelnen Agenten, sondern auf deren vernetzten Interaktionen beruht .
Information zwischen Zufall und Regelmäßigkeit
Simondon definiert Information als ein Phänomen, das weder rein zufällig noch absolut vorhersehbar ist, sondern einen „Unbestimmtheitsspielraum“ benötigt .
- LLMs: Sprachmodelle generieren Text durch Abwägung von Vorhersagbarkeit (Training auf Sprachmustern) und kreativer Variation (z. B. Sampling mit Temperaturparametern). Dieser Balanceakt spiegelt Simondons Beschreibung wider, dass Information „auf halbem Weg zwischen reinem Zufall und Regelmäßigkeit“ liegt .
- KI-Agenten: Reinforcement Learning basiert auf der Exploration von Handlungsoptionen (Zufall) und Exploitation bekannter Strategien (Regelmäßigkeit). Nur durch diese Spannung kann der Agent adaptiv lernen .
Menschliche Vermittlung und Form-Information-Transformation
Simondon betont, dass Maschinen lediglich Formen verarbeiten, während Lebewesen diese in Information übersetzen .
- LLMs: Sprachmodelle berechnen statistische Korrelationen (Formen), aber die Interpretation ihrer Outputs – z. B. die Unterscheidung zwischen Ironie und Literalität – erfordert menschliche Kontextualisierung. Ein Beispiel ist die Fehlklassifizierung von Texturen in Bildern durch KI, die menschliche Betrachter korrigieren .
- Multiagentensysteme: Autonome Systeme wie autonome Fahrzeuge generieren Datenströme (Formen), die erst durch menschliche Analyse in verkehrsrelevante Information (z. B. Gefahrenerkennung) transformiert werden .
Das Paradox des perfekten Automaten
Simondon kritisiert die Vorstellung eines „vollkommenen Automaten“ ohne Unbestimmtheit: Ohne Spielraum für Variation wird Iteration bedeutungslos .
- Generative KI: Ein LLM mit festem Temperaturparameter (keine Zufallskomponente) würde repetitive, nichtssagende Texte produzieren. Erst die Einführung von Unsicherheit (z. B. Top-k-Sampling) ermöglicht kreative Vielfalt .
- Autonome Systeme: Roboter in starren Fabrikumgebungen („geschlossene“ Automaten) scheitern in unvorhergesehenen Situationen, während adaptive Systeme (z. B. Cobots) durch sensorische Feedbackschleifen „metastabil“ reagieren .
Fazit
Simondons Philosophie zeigt, dass KI-Systeme nicht als isolierte Werkzeuge, sondern als ko-evolutive technische Objekte verstanden werden müssen. Ihre Entwicklung folgt einem Prozess der Konkretisierung (Integration von Funktionen), ihr Betrieb erfordert synergetische Vernetzung, und ihre Bedeutung entsteht erst durch menschliche Vermittlung. Der „Unbestimmtheitsspielraum“ ist dabei kein Defizit, sondern Voraussetzung für informatorische Relevanz – eine Erkenntnis, die gerade für die Ethik der KI entscheidend ist .
Von Perplexity genutzte Quellen (Auszug)
Gilbert Simondon, “philosopher of information”?
The Notion of information in early cybernetics and in Gilbert Simondon’s philosophy
On the Mode of Existence of Technical Objects by Gilbert Simondon
Hier noch ein weiteres Zitat von Simondon, das auf die enge Beziehung technischer Objekte zu ihrer Umwelt, wozu natürlich auch wir Menschen gehören, eingeht.
Der Mensch ist dazu in der Lage, die Relation zwischen dem Lebewesen, das er selbst ist, und der Maschine, die er herstellt, zu übernehmen; die technische Operation erfordert ein Leben, das technisch und natürlich ist. Das technische Leben besteht aber nicht darin, Maschinen zu lenken, sondern auf der gleichen Ebene wie diese als das Wesen zu existieren, das die Relation zwischen ihnen übernimmt, indem es gleichzeitig oder nacheinander an mehrere Maschinen gekoppelt werden kann.
Hier als Podcast