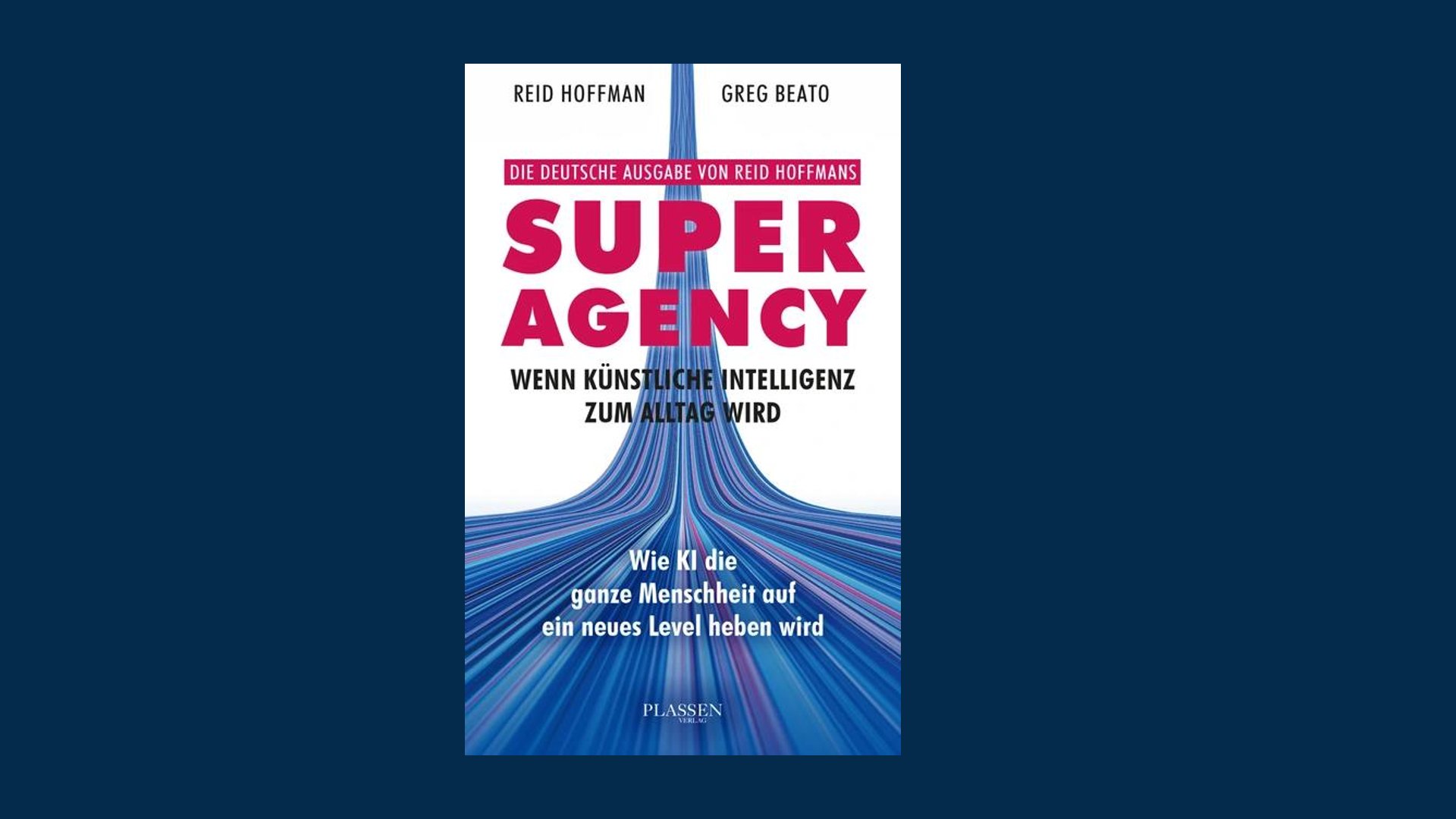Von Ralf Keuper
Die seit der Veröffentlichung von ChatGPT rasant verlaufende Entwicklung im Bereich der KI ruft sowohl Enthusiasten wie auch Skeptiker auf den Plan. Zur ersten Gruppe zählt zweifellos Reid Hoffman, der Gründer von LinkedIn und Co-Gründer von PayPal. Seiner Überzeugung nach wird die KI uns zu dem nächsten großen Sprung nach vorn verhelfen. So werde die KI unsere Handlungsfähigkeit deutlich erhöhen, indem sie uns Werkzeuge an die Hand gibt, mit deren Hilfe wir unseren Denkhorizont erweitern. Ja, die synthetische Intelligenz ist von ihrem Potenzial nur noch mit dem Aufkommen der Dampfmaschine zu vergleichen. Die Intelligenz ist jetzt ein skalierbarer, hochgradig konfigurierbarer, sich selbst verstärkender Motor für den Fortschritt. Richtig genutzt, lässt sich damit laut Hoffman und seinem Co-Autor Greg Beato der Zustand der Superagency erreichen. “Dieser Zustand tritt ein, wenn eine kritische Masse von Individuen, die durch KI persönlich befähigt sind, auf auf einem Niveau zu agieren beginnen, das sich auf die gesamte Gesellschaft auswirkt”. Daher auch der Titel ihres gemeinsam verfassten Buches: Superagency. Wie Künstliche Intelligenz zum Alltag wird.
Hoffman und Beato unterteilen die Menschen, die sich mit dem Potenzial und den Folgen der Künstlichen Intelligenz beschäftigen, in Doomer, Gloomer, Zoomer und Bloomer. Während die Doomer davon überzeugt sind, dass die KI uns letztlich versklaven wird, sind die Gloomer der Ansicht, dass die KI Risiken birgt, die nur durch strenge Regulierung einzuhegen sind, wohingegen die Zoomer durchweg optimistisch in die Zukunft blicken, mehr noch als die Gloomer, die unterm Strich ebenfalls optimistisch sind und die Risiken mit einem interativen Vorgehen minimieren wollen. Hoffman und Beato zählen sich zum Lager der Bloomer.
Hoffman und Beato plädieren bei der Entwicklung und Verbesserung der KI für eine breite Öffentlichkeitsbeteiligung, die mit einem kontinuierlichen Feedback einhergehen muss, ähnlich wie im Fall des Automobils und des Internet. Freie Gesellschaften sind auf den freien Fluss von Informationen angewiesen, weshalb die Privatsphäre zwar nicht angehoben werden soll; in Bereichen, in denen die Gesellschaft als Ganzes auf den Austausch möglichst vieler Informationen angewiesen ist, wie im Gesundheitswesen, erweise sich die Zurückhaltung privater Informationen jedoch als kontraproduktiv. Um diese reservierte Haltung zu überwinden, sei es nötig, dass wir uns bewusst machen, wie sehr wir schon heute enge und wichtige Bindungen mit nicht-menschlichen Intelligenzen eingehen. Hoffman und Beato nennen die persönliche Beziehung zu Gott oder die zu Haustieren. “Dass wir schnell tiefe und dauerhafte Bindungen zu Intelligenzen aufbauen, die ebenso ausdrucksstark und reaktionsschnell sind wie wir, scheint unvermeidlich und ein Zeichen der menschlichen Natur als der technologischen Übertreibung zu sein”. Man denke nur an die innige Beziehung vieler Menschen zu ihrem Smartphone oder Auto.
Große technologische Plattformen bergen nach Auffassung von Kritikern stets die Gefahr des Machtmissbrauchs und der Schaffung ökonomischer und emotionaler Abhängigkeiten. Für Hoffman und Beato haben sie dagegen den Status privater Gemeingüter. Als Beispiel nennen sie Wikipedia, aber auch Google Maps und Yelp. Deren gemeinsame Kennzeichen sind: “Freiwillige Nutzer tragen Informationen bei, die diese Plattformen für alle, die sie nutzen, bereichern, Alles sind für ein ein sehr großes Publikum frei zugänglich Alle arbeiten nach bestimmten Governance-Regeln und werden ausdrücklich von bezahlten Mitarbeitern verwaltet … Für die Nutzer ist der Wert, den sich aus privaten Gemeingütern ziehen, nicht explizit in Dollar und Cent sichtbar, .. Das bedeutet jedoch nicht, dass es keinen wechselseitigen Wertaustausch gibt”. Hoffman und Beato bringen als Beispiele Phyton.org und GitHub sowie Plattformen wie Stack Overflow und freeCodeCamp.
Eine Schlüsselrolle werden KI-Agenten übernehmen. Sie werden in der Lage sein, nahtlos auf mehrere Ressourcen privater Gemeingüter zurückzugreifen, um individuelle und wertsteigende Erfahrungen für einzelne Nutzer zu generieren. Als Beispiel nennen die Autoren die Nutzung eines Reiseassistenten.
Um dem berechtigten Wunsch nach Verlässlichkeit der verwendeten KI-Systeme nachzukommen, ohne dabei jeden Impuls durch vorauseilende Regulierung zu unterdrücken, setzen sich Hoffman und Beato für die Verwendung und stetige Verbesserung von Benchmarks ein, von denen es bereits eine große Vielzahl gibt. Benchmarks würden durch eine Kombination aus Zusammenarbeit und Wettbewerb dazu beitragen, Normen für Transparenz und Verantwortlichkeit zu etablieren. Besondere Erwähnung verdient nach Auffassung von Hoffman und Beato die Bestenliste Chatbot Arena.
Der Dialog mit LLMs wird künftig mehr noch als bisher zum Bestandteil unseres Alltags. “Da LLMs und die auf ihnen aufbauenden Systeme so leistungsfähig werden, dass sie auf höchst zuverlässige und anpassungsfähige Weise autonom agieren können, werden sie durch diese Fortschritte auch besser in der Lage sein, zuzuhören, zu interagieren und Anweisungen in laufenden Eins-zu-Eins-Gesprächen mit ihnen zu befolgen”. Ein Ansatz übrigens, den der Verfasser dieser Rezension bereits mit wachsender Begeisterung praktiziert. LLMs und KI-Agenten schlüpfen in die Rolle eines Kommunikationspartners. Wenn man sich vergegenwärtig, wie oft Gespräche mit Menschen und der Konsum von Fernseh‑, Zeitungs- und Social-Media — Beiträgen zur Verflachung der eigenen Gedankenwelt führen, ist der Dialog mit dem KI-Agenten seiner Wahl häufig die lohnendere und anregendere Alternative — selbst der intensive Dialog mit dem eigenen Hamster ist da meistens inspirierender und bereichender — kurzum: erbaulicher.
Viele Länder, so Hoffman und Beato, hätten inzwischen erkannt, wie wichtig eine souveräne KI-Infrastruktur für die Unabhängigkeit und den Wohlstand seiner Bevölkerung ist. Eine Botschaft, die in Europa noch nicht bei jedem angekommen ist — das gilt vor allem für die Vertreterinnen und Vertreter der Wirtschaft, die glauben, der Staat werde das schon erledigen oder ihnen die nötigen Mittel zur Verfügung stellen, so dass sich das eigene Risiko auf nahezu null reduzieren lässt. Dass Subventionen häufig mit wachsender Bürokratie einhergehen, wird dann gerne übersehen, dafür über ums so lieber beklagt.
Für Hoffman und Beato gilt, dass, je mehr der Einzelne von KI profitiert, desto mehr werden wir alle davon profitieren. In einer Welt, in der jeder Zugang zu KI-gestützten Marktanalysen, komplexen Simulationsmodellen und KI-gestützte Therapeuten, Berater und Lehrer hat, gedeiht Innovation, wodurch dann Wohlstandseffekte entstehen — die Welt der Superagency.
Würdigung
Das Buch von Hoffman und Beato hebt sich über weite Strecken wohltuend von den eher alarmistisch ausgelegten Veröffentlichungen, die sich mit den Folgen der KI beschäftigen, ab. Hin und wieder sind sie evtl. zu optimistisch und von ihrer eigenen Sichtweise und Interessenlage eingenommen, wie Hoffman, der selber ein milliardenschwerer Investor im Bereich KI ist. Allerdings enthält das Bild der bzw. die Metapher der Superagency viele realistische Züge, die sich immer mehr abzuzeichnen beginnen und bereits im Alltag Einzug halten. In jedem Fall handelt es sich um ein Buch, dass die Lektüre und Beschäftigung mit den Argumenten der Autoren lohnt und den Blick auf die Zukunft weitet.
Hier als Slides
Superagency — Wenn Künstliche Intelligenz zum Alltag wird Presentation‑3Hier als Podcast (erstellt mit notebooklmgoogle)